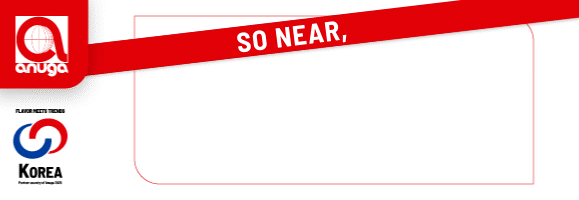28.07.2009
Vietnam: FoS zertifiziert Garnelen-Züchter
Friend of the Sea (FoS) hat die Shrimps (Litopenaeus vannamei) von Hue Fisheries, einem führenden Garnelen-Produzenten in Vietnam, für den japanischen und den europäischen Markt zertifiziert, teilt die Umweltorganisation mit. „Die Farm wurde von einem internationalen Zertifizierer auditiert und entspricht den strikten Ansprüchen an Nachhaltigkeit, die Friend of the Sea verlangt“, heißt es in einer Presseerklärung. Hue Fisheries verarbeitet mit 600 Mitarbeitern neben Garnelen auch verschiedene Arten Tintenfisch. Das Unternehmen, 1994 gegründet und seit 2004 börsennotiert, setzt nach eigenen Angaben rund 7 Mio. USD um. Exportiert wird unter der Marke Fideco zu 90% nach Japan, aber auch nach Europa.27.07.2009
Chile: Lachsfarmer setzten mehr als 300 Tonnen Antibiotika ein
Die chilenische Lachsindustrie hat ihren Salmoniden im vergangenen Jahr 325,6 t Antibiotika verabreicht (2007: 385,6 t). Diese Zahl nennt die internationale Meeresschutzorganisation Oceana unter Berufung auf einen Bericht des chilenischen Wirtschaftsministeriums, schreibt Fish Information & Services (FIS). Am häufigsten wurden die Antibiotika Florfenicol (184 t oder 56,7% der Gesamtmenge) und Flumequin (32,2 t oder 9,9%) verwendet. Alex Munoz, stellvertretender Präsident von Oceana Südamerika, wertete die Menge als klaren Hinweis auf „die schlechten Gewohnheiten der Lachsindustrie“. Norwegen, weltweit führender Produzent von Zuchtlachs, setzte allerdings nur 649 kg Antibiotika ein – ein 500stel der chilenischen Menge. Chiles Wirtschaftsminister Hugo Lavados kritisierte den Vergleich mit dem skandinavischen Land als unfair, da die Produktionsformen sich unterschieden. Die Zeitung Diario Financiero zitiert den Minister mit dem Hinweis, die Antibiotika stellten kein Gesundheitsrisiko dar, da „die Unternehmen den Fisch im Zeitraum vor der Ernte nicht behandeln“ und die Arzneimittel deshalb nicht bis zum Verbraucher gelangten.27.07.2009
Bulgarien: „Europas größte Bio-Muschelfarm“ im Bau
In der bulgarischen Bucht von Kavarna am Schwarzen Meer soll Europas größte Zucht für Bio-Muscheln entstehen, meldet Fish Information & Services (FIS). Das bulgarisch-irische Joint-Venture Black Sea Shells Ltd. will im Endstadium 2015 auf 200 Hektar Fläche jährlich 3.500 t Miesmuscheln (Mytilus galloprovincialis Lam.) von Langleinen ernten. Gegenwärtig werden in der Farm täglich ein bis zwei Tonnen Miesmuscheln produziert. Seit 2004 sei die Farmtechnologie in Kooperation mit den irischen Muschelzüchtern Noel McGreal, Danny McNulty (Atlantic Blackshells) und Hugh Wilhare (Mulroy Bay Mussels) sowohl in der Region Kavarna als auch in der Irischen See getestet worden. Dabei hätten die Gehege auch Windstärke 9 auf der Beaufortskala und Windgeschwindigkeiten bis zu 130 km/h widerstanden, teilte Geschäftsführer Naiden Stanev (40) mit. Ein im Rahmen des Förderprogramms SAPARD gebautes Schiff fährt Arbeiter zu den Plattformen, wo Muschelsaat ausgebracht und erntereife Miesmuscheln gereinigt und sortiert werden. Untersuchungen des Instituts für Fischerei und Aquakultur in Varna hätten ergeben, dass die Bucht frei sei von Muschelgiften wie DSP und PSP. Black Sea Shells besitzt eine Bio-Zertifizierung, die Produktion wird von dem Schweizer IMO-Institut kontrolliert.27.07.2009
Thailand: Seafood-Ausfuhren fallen 23,5 Prozent
Thailand hat im ersten Halbjahr 23,5 Prozent weniger Seafood ausgeführt, meldet die Tageszeitung The Nation. Die Branche werde in diesem Jahr eine Phase der Konsolidierung mit zahlreichen Insolvenzen erleben, prognostizierte Poj Aramwattananon, Präsident der Thailändischen Vereinigung für Tiefkühl-Seafood. „Viele Unternehmen haben versäumt, auf den Wandel zu reagieren. Viele leiden unter Kapitalmangel, seit die Ausfuhren rückläufig sind, einige haben an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt, weil sie keine Rohwaren bekommen“, sagt Poj. Trang Seafood Products, größter Seafood-Verarbeiter in der Provinz Trang, mit ehemals 2.000 Mitarbeiter, hat seine Fabrik vorläufig geschlossen. Sollte ein Joint-Venture-Partner gefunden werden, sei die Wiederaufnahme des Betriebes geplant. Auch die Aufwertung der thailändischen Währung, des Baht, in den letzten Monaten erschwere den Wettbewerb etwa mit Exporteuren aus Indonesien, Indien und Bangladesch. Eine von den Produzenten geforderte Reduzierung der Einfuhrzölle für Rohwaren lehnt Thailands Finanzministerium jedoch ab – zu groß wären die Einbußen für die Staatskasse.24.07.2009
USA: Amerikaner essen weniger Fisch und Seafood
Der US-Bürger hat im vergangenen Jahr 2008 durchschnittlich 16 Pfund (7,264 kg) Fisch und Schalentiere gegessen. Das sind 0,3 Pfund (136 Gramm) weniger als 2007 und die geringste Verzehrmenge seit 2002, teilt das National Fisheries Institute (NFI) mit. Insgesamt konsumierten die US-Amerikaner 2008 rund 2,079 Mio. t Fisch, Krusten- und Schalentiere – 6,7% weniger als 2007 (2,229 Mio. t). Dafür zahlten die US-Verbraucher geschätzte 49 Mrd. €. Die Rangfolge der beliebtesten Fisch- und Seafood-Arten hat sich nicht geändert. Mehr als ein Viertel der Verzehrmenge entfällt auf Shrimps (1,861 kg) und weitere 17% auf Thunfisch-Konserven (1,271 kg). Der Konsum von Lachs und Alaska-Pollack ist im Vorjahresvergleich um 273 bzw. 182 Gramm pro Kopf zurückgegangen. Ein Plus verzeichnen die Zuchtfische Tilapia (+22 Gramm) und Catfish (+78 Gramm). Der Umstand, dass auf die Top Ten in den letzten Jahren zunehmend weniger Menge entfallen ist, spricht für eine wachsende Differenzierung beim Seafood-Verzehr.24.07.2009
Bizerba baut weltweit 300 Stellen ab
Das Technologieunternehmen Bizerba entlässt fast ein Zehntel seiner Beschäftigten, teilte die im baden-württembergischen Balingen ansässige Geschäftsleitung mit. Aufgrund der weltweiten Konjunkturauswirkungen sei Bizerba gezwungen, 300 der weltweit 3.100 Arbeitsstellen abzubauen. Die Maßnahmen betreffen alle Bereiche des Konzerns inklusive des Stammsitzes. Außerdem werden die individuelle Arbeitszeit und entsprechend das Entgelt zunächst bis Ende des Jahres um 8,57 Prozent verringert. Ob weitere Einschnitte notwendig werden, hänge von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab, sagte Matthias Harsch, Sprecher der Geschäftsführung. Bizerba bietet professionelle Systemlösungen im Bereich der Wäge-, Informations- und Food-Servicetechnik in den Segmenten Retail, Food-Industrie und Logistik. Mit 29 eigenen Gesellschaften in 20 Ländern und 60 Ländervertretungen weltweit setzte Bizerba 2008 im Konzern 430 Mio. € um.23.07.2009
Peru: Weltgrößte Fischerei startet MSC-Zertifizierung
Die peruanische Sardellen-Fischerei lässt sich nach den Kriterien des Marine Stewardship Councils (MSC) auf ihre Nachhaltigkeit prüfen, meldet das norwegische Portal IntraFish. Die Vereinigung peruanischer Sardellen-Produzenten, eine Gruppe von Verarbeitern und Exporteuren, hat sich dafür ausgesprochen, die mit einer Fangmenge von sieben Millionen Tonnen weltweit größte Fischerei durch einen unabhängigen Zertifizierer beurteilen zu lassen. Bis 1950 wurden die Sardellen überwiegend für den menschlichen Verzehr gefischt. Seit 1953 die erste Fischmehlfabrik in Peru ihren Betrieb aufnahm, wird der Fisch in erster Linie zu Fischmehl- und Fischölprodukten verarbeitet. 1972 hatten fischereilicher Druck und Umwelteinflüsse wie El Nino, veränderte Strömungen im Pazifik, zu einem Zusammenbruch geführt. Dank erfolgreicher Managementbemühungen von Regierungsseite hat sich die Fischerei erholt und macht trotz verstärktem Auftreten von El Nino-Ereignissen insbesondere in den 1990er Jahren Fortschritte. Seit einem Jahr hat Ocean Nutrition Canada, Hersteller von Nahrungsmittelzusatzstoffen, mit dem Produzentenverband die Chancen einer MSC-Zertifizierung diskutiert, sagt Daniel Emond, Geschäftsführer von Ocean Nutrition: „ONC ist stolz, die Entscheidung der Vereinigung peruanischer Sardellen-Produzenten zu unterstützen, sich freiwillig einer Überprüfung nach MSC-Standards zu unterziehen.“22.07.2009
Mecklenburg-Vorpommern: Aufbau einer Edelkrebs-Aquakultur
Schon vier Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern haben damit begonnen, den heimischen Edelkrebs (Astacus astacus) aufzuziehen, meldet das dortige Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz. Um die noch junge Branche zu stärken, wurde das Forschungsprojekt „Aufbau und Entwicklung einer Edelkrebsaquakultur in Mecklenburg-Vorpommern“ gestartet. „Mit der Produktion von Edelkrebsen soll langfristig eine regionale und hochwertige Marke als einheimisches Gegengewicht zu importierter Ware oder nicht heimischen Arten etabliert werden“, sagte Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus. In den Jahren 2005 bis 2008 wurde in den vier Betrieben damit begonnen, Elternpopulationen aufzubauen, die eine Basis für die Bereitstellung von Satzkrebsen bilden. Gleichzeitig wurden verschiedene Verfahren des Erbrütens und der Aufzucht von Jungkrebsen untersucht. Zum Vorreiter entwickelte sich im Projektzeitraum der Produktionsstandort „Krebsgarten Basthorst“, der aus EU- und Landesmitteln rund 100.000 Euro erhielt und eng mit dem Institut für Fischerei der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei in Rostock zusammenarbeitet.22.07.2009
Dänemark: Makrele und Hering erhalten MSC-Zertifizierung
Die Dänische Vereinigung der Schwarmfisch-Produzenten (DPPO), die schon Ende Juni die MSC-Zertifizierung für ihre Heringsfischerei in der Nordsee erhalten hatte, besitzt jetzt zwei weitere Zertifikate. Die acht der DPPO angeschlossenen Mitgliedsunternehmen (Schwarmfisch-Trawler und Ringwadenfänger) können nun 17.600 t Makrele aus dem Nordost-Atlantik und 28.767 t atlanto-skandischen Hering unter dem blauen MSC-Logo vermarkten. Die nach der neuen Fischerei-Bewertungs-Methodologie (FAM) des MSC durchgeführte Bewertung konnte in der Rekordzeit von nur achteinhalb Monaten abgeschlossen werden. „Das zeigt uns, dass sich die Verwaltung der Fischereien in Dänemark auf einem hohen Niveau von Transparenz und Zuverlässigkeit befindet,“ kommentierte DPPO-Direktor Christian Olesen. Camiel Derichs, MSC-Manager für Nordeuropa, hob hervor, dass die Fischerei auf den atlanto-skandischen Hering ihr Zertifikat erhalten habe, ohne dass hieran irgendwelche Bedingungen geknüpft seien.21.07.2009
Holland führt herbstliches Fangverbot für Aal ein
Die holländische Regierung hat am Donnerstag mitgeteilt, in Zukunft ein mehrmonatiges Fangverbot für Aale zu verhängen, um die Bestände des bedrohten Fischs zu schützen, schreibt Fish Information & Services (FIS). Die Maßnahme beginnt in diesem Jahr mit einem zweimonatigen Fangstopp ab dem 1. Oktober. Im kommenden Jahr soll die Fangpause von September an drei Monate dauern. 2012 werde der Ansatz dann im Hinblick auf seine Effektivität beurteilt. „Ich weiß, dass das ein großes Opfer für die Aalfischer bedeutet, aber letztendlich ist es auch im Interesse der Industrie, dass sich die Aalbestände erholen“, erklärte die niederländische Landwirtschaftsministerin Gerda Verburg. Die Europäische Kommission muss dem Fangverbot noch zustimmen. Die Vereinigung holländischer Berufsfischer verurteilte den Regierungsbeschluss als „unverständlich, unvernünftig und unakzeptabel“. Den von dem Fangstopp betroffenen 240 kleinen Fischereiunternehmen werden insgesamt 700.000 € als Ausgleichszahlung gezahlt. „Das sind nicht einmal 1.000 € je Fischer“, zitiert die Presseagentur AFP Verbandsvertreter Han Walder. In Holland werden im Jahr etwa 1.000 t Aal gefangen.- Bremerhaven
- Insolvenz
- Abelmann-Gruppe
- Abelmann Fischfeinkost
- Heinrich Abelmann
- Abelmann Kä...
- Wilhelm Petersen ...
- Hering in ...
- Anika Grewing
- Listerien
- Schaufenster Fischereihafen
- Diepvries Urk
- Niederlande
- Urk
- Lohnverarbeitung
- Lohnverpackung
- Tiefkühllagerung
- Hendrik van ...
- Riekelt van ...
- Österreich
- Wien
- Fischimbiss
- Mehr als ...
- Streetfood
- Kaisermühlen
- Bayern
- Niederbayern