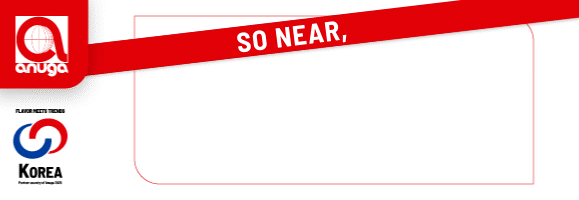27.04.2009
Island: Fischer reiten den Sturm ab
Trotz der internationalen Finanzkrise bewegt sich Islands Fischwirtschaft derzeit in ruhigem Fahrwasser, schreibt Fish Information & Services (FIS). Eirikur Tomasson, Inhaber des Fischereiunternehmens Thorbjoern, erklärte, die derzeitige Talsohle sei „nicht die schlimmste Krise, die wir erlebt haben“. Zwar habe der Sektor mit Preissenkungen von 20 bis 40% auf die fehlende Finanzkraft der Kunden reagieren müssen, doch die im Relation zum Euro schwache Isländische Krone beschere höhere Exportgewinne. Thorbjoern hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von sechs Millionen Euro. In Island bleibe die Fischwirtschaft mit einem Anteil von 36,6% an der Ausfuhr des Landes ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 2008 landeten die rund 5.000 Fischer 1,3 Millionen Tonnen im Wert von 580 Mio. € an, wovon 90% exportiert wurden.27.04.2009
Andrew Mallison wechselt von Marks & Spencer zum MSC
Andrew Mallison, bis vor kurzem Meerestechnologe bei der britischen Supermarktkette Marks & Spencer (M & S), ist neuer MSC-Direktor für Fischereistandards und die Lizenzvergabe für die Chain of Custody (CoC), schreibt das norwegische Portal IntraFish. Im Rahmen seiner zwölfjährigen Tätigkeit bei M & S hatte Mallison Standards für dessen Seafoodrange gemanaged, ein Sortiment von mehr als 25 Fischarten aus Seefischerei und Aquakultur aus 20 Ländern. „Ich war Mitglied des ersten Beratergremiums des Handels kurz nach Gründung des MSC und habe dessen Ziele seitdem unterstützt“, erklärt der studierte Fischereiwissenschaftler. Zunächst hatte Mallison einige Jahre in der australischen Fischwirtschaft gearbeitet, bevor er nach Großbritannien zurückkehrte. Während seiner 28jährigen Tätigkeit in Verarbeitung, dem internationalen Handel und dem LEH hatte er mit fast allen kommerziell wichtigen Fischarten zu tun und kam in Kontakt mit Produzenten weltweit, von Alaska bis Madagaskar.23.04.2009
EU nimmt Anlauf für neue Fischereipolitik
Die Europäische Union nimmt einen Anlauf zur Neuordnung ihrer Fischereipolitik. Die EU-Kommission hat in Straßburg ein Strategiepapier verabschiedet, das den Abschied von dem viel kritisierten Fangquoten-System einläutet. Die Bundesregierung dringt zudem auf ein Ende der Praxis, wertvolle Speisefische tot zurück ins Meer zu kippen. Bisher schreibt die EU den Fischern zum Schutz bedrohter Bestände jedes Jahr neue Höchstfangmengen vor. Diese nach Meeresregionen aufgeteilten Fangquoten für Arten wie Kabeljau oder Scholle werden aber regelmäßig überschritten und stehen deshalb bei Umweltschützern in der Kritik. „Es gibt zu viele Schiffe für zu wenige Fische“, heißt es in dem sogenannten Grünbuch der Kommission, das heute vorgestellt wurde. Brüssel schlägt deshalb ein System vor, wie es Norwegen, Island, Neuseeland und Australien praktizieren. Dort weisen die Regierungen den Fischern individuelle Fangrechte zu, die sie auf einer Art Privatmarkt handeln können. Zu den Befürwortern gehören etwa Dänemark und die Niederlande. Frankreich fürchtet, dass kleine Fischbetriebe ihre Fangrechte an große Industriefischer verkaufen müssten, da sie nicht lukrativ genug arbeiten.22.04.2009
Thailand: „Shrimp-Exporte könnten bis zu zehn Prozent steigen“
Thailands Garnelen-Züchter versprechen sich für dieses Jahr eine steigende Nachfrage für ihr Produkt – trotz der weltweiten Finanzkrise, sogar aufgrund der wirtschaftlichen Talsohle, schreibt Fish Information & Services (FIS). Der vermehrte Verzicht auf Gastronomiebesuche zugunsten heimischer Abendessen könne den Absatz der Shrimps aus Thailand um bis zu zehn Prozent steigern, meinte Poj Aramwattananond, Präsident des Thailändischen Tiefkühlverbandes (TFFA). In den ersten beiden Monaten dieses Jahres sei die Exportmenge um 19,34% auf 48.601 t gestiegen, der Wert der Ware lag mit 283 Mio. USD um 8,17% über Vorjahresniveau. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt Shrimps für 2,38 Mrd. USD ausgeführt. Angesichts der globalen Rezession haben Thailands Farmer ihre Produktion allerdings gedrosselt, so dass im ersten Quartal nur 96.000 t geerntet wurden, ein Rückgang von 15% gegenüber I/2008, teilte der Präsident der Vereinigung ostthailändischer Garnelenzüchter (TESFA) mit, Banchong Nisapavanich. Auf dem Binnenmarkt liege der Preis für Vannamei (50er Count) derzeit mit 3,90 USD/kg 10 bis 15% höher als Anfang 2008.21.04.2009
Insolvenzverfahren gegen Caviar Creator eröffnet
Am 15. April hat das Amtsgericht Neubrandenburg das Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der Caviar Creator Verwaltungs GmbH, Demmin, zur Sicherung der künftigen Insolvenzmasse und zur Aufklärung des Sachverhalts angeordnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Christian Graf Brockdorff, Potsdam, bestellt. Verfügungen der Schuldnerin sind nur noch mit Zustimmung des vorläufigen Verwalters wirksam. Rechtsanwalt Brockdorff ist ermächtigt, Bankguthaben und sonstige Forderungen der Schuldnerin einzuziehen sowie eingehende Gelder entgegenzunehmen. Der Eröffnung des Insolvenzverfahrens war ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf vorausgegangen, dass Caviar Creator zu Schadenersatz gegenüber einer Aktionärin verurteilt hat. Die Anlegerin hatte geklagt, weil sie sich falsch beraten fühlte und Caviar Creator die tatsächliche Nichthandelbarkeit der Aktien verschleiert habe. Dies und die Tatsache, dass der Anlegerin zeitlich weit vor Zeichnung das Emissionsprospekt nicht zur Verfügung gestellt wurde, sah das Landgericht Düsseldorf in dem zwischenzeitlich rechtskräftigen Urteil als Aufklärungsverschulden gemäß § 278 BGB an. Der Schutzverein der Bankkunden e.V., Passau, forderte betroffene Anleger in einer Pressemitteilung auf, demgemäß Möglichkeiten prüfen zu lassen, inwieweit hier Schadensersatzansprüche gegen die Verantwortlichen bestehen.20.04.2009
US-Industrie besorgt über lange Zertifizierung für russischen Pollack
US-amerikanische Weißfisch-Verarbeiter äußern sich besorgt über Russlands Mitteilung, die MSC-Zertifizierung seiner Alaska-Pollack-Fischerei werde drei bis vier Jahre dauern. Das norwegische Portal IntraFish zitiert Jim Gilmore, Direktor der At-sea Processors Association (APA), den Verband der US-Fabriktrawler. Demnach habe die APA den Zertifizierer Tavel, der die Alaska-Seelachs-Fischerei bewerten soll, darüber informiert, dass die US-Vereinigung in das Zertifizierungsverfahren einsteigen wolle. Es gebe „keine vernünftige Erklärung für die Ankündigung, dass die Prüfung um drei Jahre länger dauern solle als der vom Marine Stewardship Council üblicherweise vorgesehene Zeitraum. Gilmore fügte hinzu, „jüngste unglückliche politische Entscheidungen“ des MSC „könnten die russische Pollack-Fischerei zu der Annahme verleitet haben, dass Fischereien, die momentan die Nachhaltigkeitsstandards des MSC nicht erfüllen, dennoch davon profitieren könnten, wenn sie mit dem MSC-Programm über Jahre hinweg in Verbindung gebracht würden“. Er plädierte dafür, Russlands Fischerei noch in diesem Jahr zu bewerten. Russlands Alaska-Seelachs-Quote liegt im laufenden Jahr mit 1,5 Miillionen Tonnen 30 Prozent über der Quote von 2008 und könne 2010 um weitere fast 200.000 Tonnen angehoben werden, meinen Wissenschaftler des Landes.16.04.2009
Gemeinschaft führender Delikatessen-Kaufleute tagt in München
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
15.04.2009
Aalwirtschaft gründet Initiative zur Förderung des Europäischen Aals
Fischer, Verarbeiter und Händler haben in Hamburg die Initiative zur Förderung des Europäischen Aals e.V. gegründet. Ziel dieses gemeinnützigen Vereins ist der Erhalt des Aals sowie die Wiederauffüllung des europäischen Aalbestandes. „Alle Beteiligten sehen in der Sicherung der Aalbestände die Grundlage für eine nachhalte Aalwirtschaft. Daher haben wir bereits konkrete Aktionen für seinen Fortbestand geplant“, betont der erste Vorsitzende des Vereins, Ronald Menzel vom Verband der Deutschen Binnenfischerei e.V. So sind schon für Mai erste Besatzmaßnahmen vorgesehen. Im Herbst sollen dann große weibliche laichreife Aale von Fischern im Binnenland aufgekauft und in barrierefreien Küstengewässern ausgesetzt werden, um ihnen eine ungehinderte Rückwanderung in das Laichgebiet zu ermöglichen. Unterstützung erhofft sich die Initiative auch von den Betreibern von Wasserkraftwerken. Darüber hinaus ist eine enge Zusammenarbeit mit der Aalforschung, unter anderem mit dem Institut für Binnenfischerei in Potsdam, geplant sowie mit nationalen und internationalen Behörden und Umweltverbänden. Ebenso sollen europaweit stattfindende Aktionen für den Aal koordiniert werden.09.04.2009
Niederlande: Sodexo erster Contract Caterer mit MSC-Zertifizierung
Sodexo, eines der weltweit führenden Catering-Unternehmen, ist der erste Contract Caterer in den Niederlanden, der eine Zertifizierung des Marine Stewardship Councils (MSC) erhalten hat. Seit gestern dürfen die ersten vier Sodexo-Kantinen Fisch unter MSC-Label abgeben. Bis Ende des Jahres will Sodexo alle seine rund 1.300 holländischen Standorte vom MSC zertifizieren lassen. "Sodexo hat die Anforderungen, die bei der Abgabe von MSC-Produkten erfüllt werden müssen, in sein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 integriert," erklärte Qualitätsmanagerin Joke van Buuren. Die MSC-Fischprodukte seien nicht teurer als konventionelle, betonte die Sodexo-Mitarbeiterin. Der Caterer wolle seine Kunden und die Konsumenten darüber aufklären, wofür das MSC-Label stehe. Nathalie Steins, Geschäftsführerin des MSC in Holland, begrüßte diesen Promotion-Aspekt auf Ebene des Verbrauchers. Unter den Fischprodukten, die Sodexo führt, sind beispielsweise Alaska-Wildlachs sowie die holländischen Klassiker Kibbeling und Lekkerbekjes, wofür jeweils Weißfisch eingesetzt wird.09.04.2009
Surimi: US-Produktion sinkt bei anhaltender Nachfrage aus Europa
Die Surimi-Produktion in der A-Saison der US-amerikanischen Alaska-Pollack-Fischerei fällt in diesem Jahr mit geschätzten 35.000 t rund 13.000 t niedriger aus als im Vorjahr, schreibt IntraFish unter Berufung auf einen Artikel in der japanischen The Suisan Times. Voraussichtlich werde die Hälfte hiervon nach Japan verschifft. Unklar sei derzeit noch, zu welchem Preis. Angesichts einer 20%igen Kürzung der diesjährigen US-Fangquote für den Alaska-Seelachs bei anhaltend hoher Filetnachfrage aus Europa weigern sich die Surimi-Produzenten in den USA die Preise zu senken. Die United States Surimi Commission (USSC) teilte mit, der Preis werde in der diesjährigen A-Saison auf Vorjahresniveau liegen. In der A-Saison 2008 kostete das Kilogramm 3,82 € und damit 0,98 € weniger als in der B-Saison. Japans Surimi-Verarbeiter haben allerdings die im vergangenen Jahr teuer gekaufte Rohware noch nicht komplett verarbeitet. Da sie deshalb derzeit nicht dringend auf den Einkauf angewiesen seien, spekulieren sie auf eine Preissenkung um etwa 0,22 €/kg. In Südostasien weisen die Surimi-Preise momentan talwärts.- Mykoprotein
- Schweden
- Pilze
- Muscheln
- Insekten
- Axfoundation
- Älvdalslax
- Anders Kiessling
- Christian Sjö...
- Schottland
- Associated Seafoods
- Räucherfisch
- Lossie Seafoods
- Moray Seafoods
- Loch Fyne ...
- Seasalter
- Chris Orr
- Loch Duart
- Buckie
- Bremerhaven
- Insolvenz
- Abelmann-Gruppe
- Abelmann Fischfeinkost
- Heinrich Abelmann
- Abelmann Kä...
- Wilhelm Petersen ...
- Hering in ...