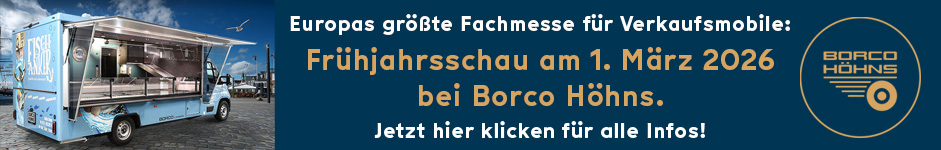18.08.2025
Nordseekrabben: Projekt des Thünen-Instituts zu Bestandsschwankungen
Die Nordseekrabbe ist für viele Küstenfischer in Deutschland die wichtigste Art. Umso bedenklicher ist es für die Berufssparte, dass die Fangerträge im vergangenen Jahr nur noch rund ein Drittel des langjährigen Durchschnitts erreichten. Warum die Bestände der Crangon crangon seit Jahren schwächeln, ist nun Gegenstand eines Projektes des Thünen-Instituts für Fischereiökologie in Bremerhaven. Das internationale Forscherteam will herausfinden, warum die Bestände so stark schwanken und es damit bislang nicht möglich ist, die Bestandsentwicklung zu kalkulieren.Klar scheine nur, dass die Nordseegarnele besonders empfindlich ist, sagt Dr. Lara Kim Hünerlage, Mitarbeiterin am Institut für Seefischerei und Mitglied des Forscherteams: Die Garnele lebt nur kurz, die Fischerei stützt sich im Wesentlichen auf den Nachwuchs eines einzigen Jahrgangs. Fällt dieser Jahrgang schwach aus, brechen die Fänge sofort ein. Wärmere Winter verändern den Reifeprozess der Garnelen. Larven schlüpfen teils zu früh, wenn kaum Nahrung vorhanden ist und überleben daher nicht. Außerdem fressen Quallen und Kalmare große Mengen Larven und können ganze Jahrgänge dezimieren. Auch Schiffsverkehr, Windparks, Hafenausbau und die Fischerei selbst beeinflussen Lebensräume und Bestandsentwicklung, erklärt Hünerlage. Bislang gebe es kein belastbares Vorhersagemodell. Damit sei es unmöglich, Fangquoten festzulegen oder den Fischern Planungssicherheit zu geben.
Für kleine Fischereibetriebe sei die Lage zunehmend existenzbedrohend. Auch Touristen und Einheimische bedauern fehlende Krabbenprodukte. Zunächst bis 2027 wollen die Wissenschaftler weiter erforschen, wie Gezeiten, Strömungen und Umweltbedingungen den Garnelenbestand beeinflussen. Doch schon jetzt sei klar: Bis das Rätsel gelöst ist, könne es deutlich länger dauern.

Foto/Grafik: Björn Marnau/FischMagazin
Warum die Bestände der Nordseekrabbe seit Jahren schwächeln, ist Gegenstand eines Projektes des Thünen-Instituts für Fischereiökologie in Bremerhaven. Foto: 2003 wurden noch mehr als 11.000 t Krabben gefangen – Anlandung in Büsum.

Foto/Grafik: Thünen-Institut für Seefischerei
Klar zu scheint zu sein, dass die Nordseegarnele besonders empfindlich ist, sagt Dr. Lara Kim Hünerlage (Foto), Mitarbeiterin am Institut für Seefischerei und Mitglied des Forscherteams.

Foto/Grafik: Thünen-Institut für Seefischerei
Wärmere Winter verändern den Reifeprozess der Garnelen. Larven (Foto) schlüpfen teils zu früh, wenn kaum Nahrung vorhanden ist und überleben daher nicht. Außerdem fressen Quallen und Kalmare große Mengen Larven.
Folgende Artikel könnten Sie auch interessieren
[13.02.2026] Frosta: Umsatz bei Fisch steigt stärker als der Markt[12.02.2026] Friesenkrone vergibt drei Stipendien für die Weiterbildung zum Fischsommelier
[12.02.2026] Bremerhaven: Isey und Fimex im Insolvenzverfahren
[09.02.2026] Bremerhaven: Raum für innovative Ideen rund um Fischzucht und Aquakultur
[29.01.2026] Bremerhaven: Weiterhin keine Einigung im Tarifstreit bei Deutsche See
[28.01.2026] FIZ & Freunde-Netzwerkabend: Was bewegt die Menschen an der Fischtheke?
[13.01.2026] Bremerhaven: NGG bestreikt heute Deutsche See Fischmanufaktur
[13.01.2026] Bremerhaven: Thünen-Institut bereitet Ansiedlung der Europäischen Auster vor
[04.12.2025] Bremerhaven: 75 Jahre Natusch Fischereihafen-Restaurant
[27.11.2025] Nordseekrabben: Niederländer fischen illegal